The afterlife of voids and traces was an exhibition, that artistically approaches voids and traces of Nazi Crimes in our everyday surrounding, like remains of forced labour camps in germany.

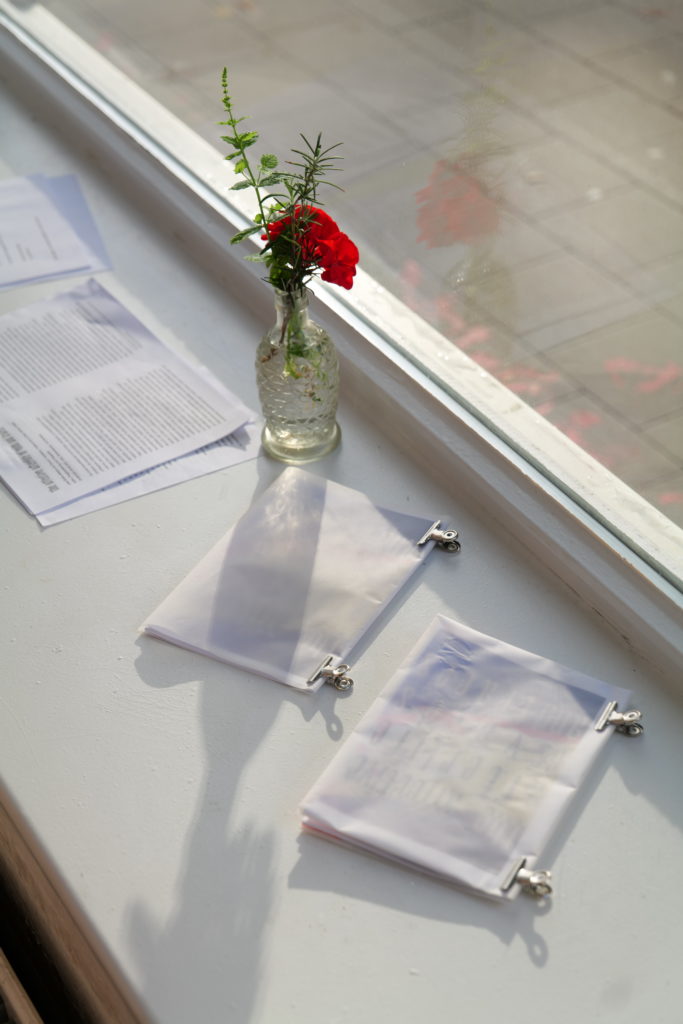


Die Arbeit the affective afterlife of voids and traces beschäftigt sich mit fünf Orten, die Spuren von Naziverbrechen zeigen: Schienen, die nirgendwo mehr hinführen, die aber nach genauer Recherche mit umliegenden Außenlagern in Zusammenhang standen. Bunkerreste in Wäldern, Laternen, die Orten der Zwangsarbeit zugeordnet werden können. Oftmals findet an diesen Orten keine oder unzureichende Vermittlung von Wissen über sie statt. Unzureichend bedeutet, was sich immer spüren aber schwer in Worte fassen lässt: denn nicht selten stellt sich das Gefühl ein, Orte des Gedenkens würden nur soweit geschaffen, wie es „eben sein muss“. Dies findet durch verschiedenste Formen Ausdruck: die gewählten Formulierungen wirken nur allzu oft so, als wären Nazis eines Tages mit einem Ufo gelandet. Ganz so, als wäre nicht jede Stadt, jeder Ort ein aktiv wissender und handelnder Teil des Holocaust gewesen. Immer noch wird in diesen Texten versucht, die Schuld zu nicht greifbaren „Dritten“, den Nazis, unter Verschleierung der Tatsache, dass es die Stadtbewohner:innen selbst waren, zu verschieben, dafür die Grausamkeit des Krieges an sich in den Vordergrund zu stellen (der ja für „alle“ schlimm war) und die vorbildliche Erinnerungskultur Deutschlands zu betonen. Es findet auch Ausdruck in einem der zahllosen Gedenksteine am Straßenrand, auf dessen unebener und dunkler Oberfläche ebenso dunkle Buchstaben angebracht oder eingehauen wurden, die kaum lesbar sind, selbst dann nicht, wenn man direkt davor stünde, doch das ist nicht selten unmöglich. Sie stehen oft am Rande vielbefahrener Straßen, ohne eine Möglichkeit anzuhalten. So wird nicht einmal klar, wofür diese Steine stehen, sie könnten ebenso einen Motorradunfall betrauern oder zum Wald-Erlebnispfand in 5km Entfernung verweisen. Im Gegensatz dazu stehen Denkmäler der Weltkriege in bestens restauriertem Zustand, groß, nicht zu übersehen und meist umgeben von gut gepflegten Grünanlagen in jeder Ortschaft. Diesen letzten Punkt könnte man nun noch weiter diskutieren, das ist jedoch nicht Gegenstand der künstlerischen Auseinandersetzungen in diesen Arbeiten. Es geht vielmehr darum, was mit den mehr und mit den weniger sichtbaren Spuren geschieht: oftmals gar nichts. Sie werden dem Verfall überlassen, einverleibt oder abgerissen. Sie werden unsichtbar gemacht ohne tatsächlich versteckt zu werden. Man begnügt sich damit, dass sie „untergehen“ im Waldboden, zwischen Baumstämmen, unter neuer Nutzung ihrer Flächen.
Das Nachleben der Leerstellen, der Spuren und ihrer Geschichten, ist dennoch spürbar, sichtbar, hörbar, sobald man um ihre Existenz weiß. Dann ist es, als würden sie leuchten zwischen dem Geäst oder in einer Reihe von Häusern und jedes Mal, wenn man ihnen folgt, erweisen sie sich als wahr.
Das Onlineprojekt avArc. A LANDSCAPE OF MEMORY AND TEMPORALITIES, ist ein kollektives, sich im Prozess befindendes Projekt, dessen Teil die Malerei- und Soundinstallation als künstlerische Intervention ist. Initiiert von dem Informatiker und Fotografen Stefan Wahler und der Künstlerin und Kunstwissenschaftlerin Julia Stolba, beschäftigt sich das Projekt mit Fragen nach dem Umgang mit der Transformation von Erinnerung und Erinnerungsorten sowie deren Verzeichnung und Archivierung. Mit unserer Arbeit möchten wir dazu beitragen, die, wie Aleida Assmann sie nennt, „transformierenden Kraft der Erinnerung […] [die] mit dem Wissen und dem Erkenntnisstand der Gegenwart vermittelt werden [kann].“[1], in die zunehmenden Überschneidungen des analogen und digitalen Lebens einzubringen.
An diversen Stellen in Städten, größeren Gemeinden etc. besteht und wächst Wissensvermittlung zu Erinnerungsorten bereits sehr umfassend. Diese Orte und die damit verbundene, relevante Erinnerungsarbeit wollen wir in unserer Arbeit keineswegs außer Acht lassen und sie vielmehr in unsere Arbeit mit einbeziehen.
Dennoch finden sich immer noch Orte der Nazi-Verbrechen, welche neben den im Wissenskanon etablierten Konzentrationslagern stehen und an denen oftmals kaum noch etwas oder gar nichts mehr an das Geschehene erinnert. Zumeist erfolgt an diesen Orten keinerlei Kontextualisierung oder Wissenstransfer und wenn doch, ausgehend von lokalen Initiativen, Aktivist:innen und/oder den Nachkommen der Opfer. Meist wird diese Arbeit aus eigner Kraft und eigenen Ressourcen geleistet, wenn überhaupt, prekär finanziert und stößt dabei nicht selten auf heftige Gegenwehr. So ist das, was erinnert wird, stets umkämpft.[2]
Gleichwohl ist an jeder Stelle, die man auf einer Karte markieren könnte, ein Ort von Geschichte und Geschichten auszumachen, die nicht vergessen werden sollten. Dieser Gedanke, in der Welt zu sein und dabei wissen zu können, dass an jedem Ort, an dem man sich befindet, etwas war, war ausschlaggebend für unsere Überlegungen und Pläne des Projekts hinsichtlich des Umgangs mit jenen Orten, die immer überall sind. Ausgehend von diesen Überlegungen und unserer künstlerischen und theoretischen Praxis, möchten wir als artistic research an der Schnittstelle von lokalem Bezug und Digitalität, die Geschichte von Orten als Erinnerungsorte, die verschwinden, unsichtbar sind oder verhindert werden, thematisieren. Unser Ziel ist es, Strategien zu finden, durch die sich die Geschichten dieser Orte in das Archiv des kollektiven Wissens einschreiben, es aktualisieren und von ihm aktualisiert werden können. Damit meinen wir konkret, dass es nicht mehr möglich sein soll, sich an Orten, die mit der Geschichte der NS-Verbrechen und des antifaschistischen Widerstandes in Zusammenhang stehen, aufzuhalten, ohne dies zu wissen.
Sowohl bereits erschlossene als auch bisher oder inzwischen verborgene Erinnerungsorte werden in einem commons-basierten, virtuellen Opensource-Atlas (als Alternative zu Plattformen wie Google Maps oder Google Earth) markiert und visualisieren so eine Kartografie der Erinnerung für die Gegenwart und Zukunft, in der dann alternative, zum bestehenden Wissenskanon gegenhegemoniale Geschichten der Welt erzählt werden und in ständiger Bewegung wachsen. Personen, die sich an einem bestimmten Ort aufhalten, sollen mittels des Projekts an die Geschichte dieses Ortes gelangen, beispielsweise durch QR-Codes. Diese könnte man in diesem Zusammenhang als kleinstmögliche und jedoch gleichsam unmissverständlich codierte Verweise auf Erinnerungsorte begreifen, hinter denen sich eine Verkettung virtuell versammelten Wissens erschließt. Da das im Laufe des Projektes entstehende Archiv als Langzeitarchiv angelegt ist, dem eine niemals abgeschlossene Aktualisierung inhärent ist, wird es unabdingbar, ein Kollektiv zu bilden, das gemeinsam an dem Projekt arbeitet und eng mit Initiativen, AktivistInnen und Communities verbunden ist, deren Wissen zu einzelnen Orten und Geschichten bereits in diversen Publikationen, Aktionen und Interventionen aufgearbeitet existiert. Einen weiteren, maßgeblichen Anteil des Vorhabens bilden künstlerische Interventionen jeder Form, die sowohl lokal präsent als auch virtuell stattfinden können und digital aufbereitet werden. Künstlerische Forschung kann dabei auch als affektive Art der Wissensvermittlung agieren und Gedenkorte schaffen, wo dies physisch nicht mehr möglich ist, verhindert oder nicht gewollt wird.
Der Titel “Affective Archive. A Landscape of Memory and Temporalities”, nimmt Bezug auf die Art unserer Arbeit – als einer affektiven, die mittels künstlerisch-forschender Strategien versucht, mikropolitische Verschiebungen der Erinnerung und der Wahrnehmung zu erzeugen.
“Repertoire is an embodied collective store of knowledge that individuals in a group can access. One can participate in it actively by singing a song and all its verses, for example, or passively by humming along to the melody.” [3]
Diese Gedanken zur Teilhabe und Teilnahme an Aktivierungen und Erneuerungen von Erinnerung, betreffen den eigentlich wichtigsten und in jedem Fall unerlässlich notwendigen Anteil des Projekts: die Gemeinschaft, die solch ein großes, weitreichendes und langfristiges Vorhaben erst ermöglicht. Es wäre nicht realisierbar und auch sinnlos, dies allein zu gestalten, denn es bedarf der Perspektiven und Stimmen von Vielen sowie ihrer Ressourcen und Professionen, um die Umsetzung des Konzeptes zu erreichen.
Wir möchten die Plattform des Affektiven Archivs nutzen und zur Verfügung stellen, um Erinnerung zu erweitern und zu teilen. Mehr zum Projekt findet sich unter www.avarc.org, die Suchmaschiene zu den verzeichneten Orten unter www.archive-avarc.org und die Möglichkeit mit zu gestalten bei https://community.avarc.org/
join us!
[1] Vgl. Aleida Assmann: Die verwandelnde Kraft des Erinnerns, in: Jürgen Moltmann: Das Geheimnis der Vergangenheit, Berlin 2012, S.81.
[2] Vgl. Nora Sternfeld: Errungene Erinnerungen. Gedenkstätten als Kontaktzonen, in (dies.): Das radikaldemokratische Museum 2018, S.136-S.144.
[3] Vgl. Aleida Assmann, The Body as the Medium of individual, collective and cultural memory” , in: Akademie der Künste, Berlin (ed.), Jornal der Künste, No.12, English issue, March 2020, pp. 12-17.

